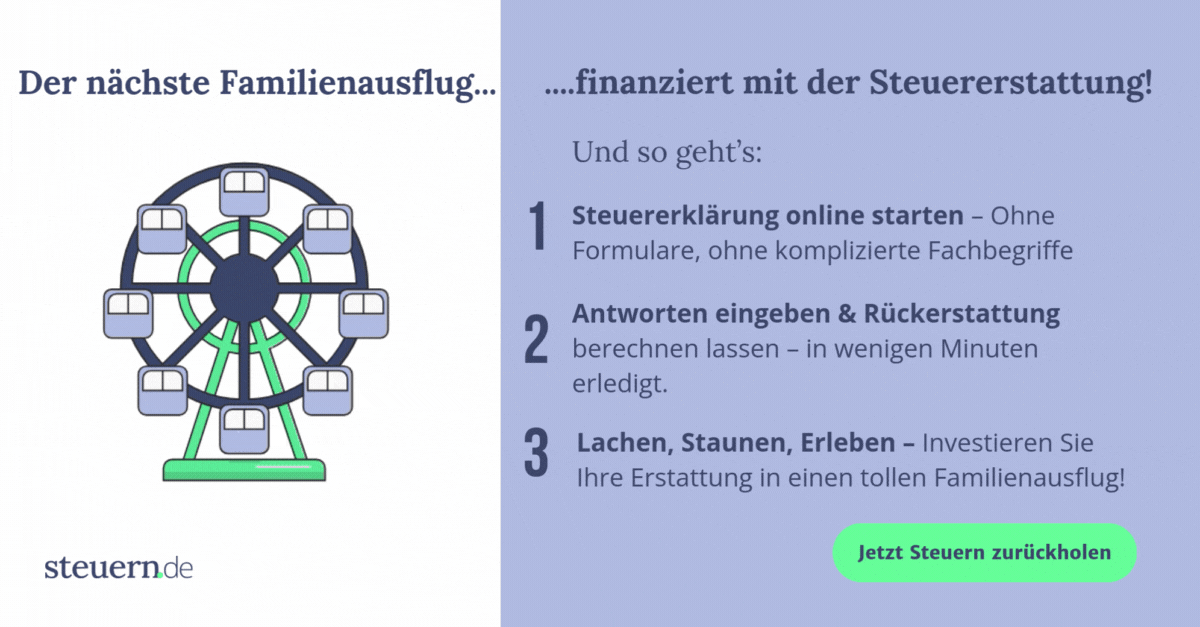Grundsteuer und Grundsteuererklärung

Was ist die neue Grundsteuer C?
- Die Grundsteuerreform 2025 hat die Grundsteuer C eingeführt.
- Mittels dieser Steuer können Gemeinden künftig für baureife unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen, wenn dort keine Bebauung erfolgt. Diese Grundstücke wurden meist als Spekulationsobjekte von den Eigentümern gehalten, um eine Wertsteigerung abzuwarten.
- Der höhere Hebesatz der Grundsteuer C verteuert die Spekulation und schafft Anreize, auf baureifen Grundstücken Wohnraum zu schaffen.
Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden in Deutschland. Besteuert werden damit Grundstücke und deren Bebauung. Seit dem Jahresbeginn 2025 greift nun eine grundlegende Reform. Immobilien- und Grundstückseigentümer:innen mussten jedoch schon vorab handeln und eine Grundsteuererklärung beim Finanzamt einreichen. Erfahren Sie hier, wie Sie die Grundsteuer berechnen, welche Arten der Grundsteuer es gibt und was Sie sonst noch über die Grundsteuer wissen sollten.
Mit einer Steuersoftware erstellen Sie Ihre Steuererklärung schneller, sicherer und einfacher. Welche ist die richtige für Sie? In unserem Steuersoftware-Vergleich finden Sie eine passende Lösung.
Was ist die Grundsteuer einfach erklärt?
Die Grundsteuer wird auch Grundbesitzsteuer genannt und betrifft (fast) alle, die eine Immobilie oder ein Grundstück besitzen. Sie wird jährlich von den Kommunen erhoben und besteuert Grundbesitz im Inland. Dazu gehören unter anderem:
- Bebaute und unbebaute Grundstücke,
- Erbbaurechte an Grundstücken,
- Eigentumswohnungen,
- Ein- und Zweifamilienhäuser oder Reihenhäuser,
- land- und forstwirtschaftliche Flächen.
Jedes Grundstück und jede wirtschaftliche Einheit einer Immobilie – also jedes Objekt – erhält vom Finanzamt eine eigene Steuernummer. Bei der Grundsteuer sprechen Expert:innen daher auch von einer Objektsteuer. Die Eigentümer:innen (beziehungsweise Erbbauberechtigten) dieser Objekte zahlen die Grundsteuer an das jeweilige Lagefinanzamt. Das zuständige Lagefinanzamt ist das Finanzamt, in dessen Bezirk ein Grundstück, ein Betriebsgrundstück oder eine Immobilie nach § 18 (1) Abgabenordnung (kurz AO) gelegen ist.
Tipp: Zuständiges Lagefinanzamt finden Sie möchten herausfinden, welches Finanzamt für Sie zuständig ist? Unsere Finanzamtsuche hilft Ihnen dabei!
Grundsteuerarten: Was bedeutet Grundsteuer A, B, C?
Das Grundsteuergesetz (GrStG) unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten der Grundsteuer:
- Grundsteuer A („agrarisch“)
wird für den Grundbesitz von Betrieben der Forst- und Landwirtschaft erhoben. - Grundsteuer B („baulich“)
fällt auf bebaute und unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte und Teileigentum an. - Grundsteuer C
wurde mit der anstehenden Grundsteuerreform 2025 eingeführt. Mit dieser neuen Grundsteuerart können Kommunen unbebaute baureife Grundstücke höher besteuern. Dadurch soll es für Eigentümer:innen unattraktiver werden, Grundstücke aus Spekulationszwecken zu halten. Zudem soll neuer Wohnraum schneller entstehen.
Ihre Meinung ist gefragt Welche Erfahrungen haben Sie mit der Grundsteuererklärung gemacht? Fühlen Sie sich gut informiert?
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an unserer kurzen Umfrage.
An Umfrage teilnehmen
Grundsteuerreform: Warum war eine Reform nötig?
Die Berechnung der Grundbesitzsteuer wurde schon sehr lange kritisiert. Der Hauptgrund der Kritik ist, dass mit stark veralteten Einheitswerten gerechnet wurde. Diese Werte entscheiden mit darüber, wie hoch ein konkretes Objekt besteuert wird. So wurde in den alten Bundesländern noch mit den Einheitswerten von 1964 gerechnet – in den neuen Bundesländern sogar mit Werten von 1935. Auch wurde am Beispiel Berlin offensichtlich, dass vergleichbare Grundstücke in der gleichen Stadt sehr unterschiedlich besteuert wurden.
Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass dies nicht mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz des deutschen Grundgesetzes vereinbar sei. Daher wurde die Grundsteuerreform notwendig, die zum 1. Januar 2025 endgültig in Kraft trat. Eigentümer:innen mussten deshalb bis 31. Januar 2023 handeln und eine elektronische Grundsteuererklärung abgeben.
Unser Tipp: smartsteuer-Grundsteuererklärung Mit dieser Lösung können Betroffene ihre Grundsteuererklärung digital abgeben – schnell, einfach und sicher.
Jetzt loslegen!
Weitere Informationen dazu, was die Reform für Sie verändert, finden Sie in unserem Artikel zur Grundsteuerreform.

Welche Faktoren beeinflussen die Grundsteuer?
Die Grundsteuer ergibt sich aus drei Faktoren:
- Einheitswert (ab 2025: Grundsteuerwert)
- Steuermesszahl
- Hebesatz
Sehen wir uns diese drei Bestandteile etwas näher an:
Was ist der Einheitswert?
Der sogenannte Einheitswert ist die Grundlage der Grundsteuer-Berechnung. Er gilt jeweils für ein Objekt (Grundstück, Haus oder Wohnung) und gibt vereinfacht gesagt den steuerlichen Wert des Grundstücks wieder, also den Wert in Euro. Die Größe und Lage des Grundstücks, aber auch die Art der Bebauung beeinflussen diesen Wert. Der Einheitswert wird vom zuständigen Finanzamt bestimmt und den Grundstückseigentümer:innen mitgeteilt.
Eigentlich sollten die Einheitswerte im Sechsjahrestakt neu bewertet werden – das ist jedoch nie passiert. Daher wurde 2025 die Grundsteuerreform nötig, in deren Rahmen die Werte neu erhoben wurden. Der neu ermittelte Grundsteuerwert basiert auf dem sog. Bundesmodell und ersetzt ab 2025 den bisherigen Einheitswert.
Was verbirgt sich hinter der Grundsteuermesszahl?
Die Grundsteuermesszahlen werden von der Bundesregierung festgelegt. Die Grundsteuermesszahl ist ein Faktor (Angabe in Promille), um verschiedene Formen von Immobilien unterschiedlich bewerten zu können.
In den alten Bundesländern galten bis 31.12.2024 diese Steuermesszahlen:
- 2,6 Promille für Einfamilienhäuser für die ersten 38.346,89 Euro des Einheitswerts
- 3,1 Promille für Zweifamilienhäuser
- 3,5 Promille für den Rest des Einheitswerts von Einfamilienhäusern
- 3,5 Promille für alle restlichen Immobilien (z. B. Eigentumswohnungen, Wohnungserbbaurecht etc.)
- 6,0 Promille für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
In den neuen Bundesländern wurden die Grundsteuermesszahlen bis 2024 hingegen von der Einwohnerzahl der Gemeinde bestimmt:
| Grundstücksgruppe: | Einwohnerzahl: | ||
|---|---|---|---|
| bis 25.000 | 25.001 bis 1.000.000 | Über 1.000.000 | |
| Altbauten ohne Einfamilienhäuser | 10 Promille | 10 Promille | 10 Promille |
| Neubauten ohne Einfamilienhäuser | 8 Promille | 7 Promille | 6 Promille |
| Einfamilienhäuser Altbauten bis 15.338,76 EUR Einheitswert | 10 Promille | 8 Promille | 6 Promille |
| übersteigender Betrag | 10 Promille | 10 Promille | 10 Promille |
| Einfamilienhäuser Neubauten bis 15.338,76 EUR Einheitswert | 8 Promille | 6 Promille | 5 Promille |
| übersteigender Betrag | 8 Promille | 7 Promille | 6 Promille |
| unbebaute Grundstücke | 10 Promille | 10 Promille | 10 Promille |
Ab 2025 gelten neue Steuermesszahlen
Die Grundsteuerreform ist zum 1.1.2025 in Kraft getreten. Mit der Neufassung des Grundsteuergesetzes werden die Steuermesszahlen vereinfacht – allerdings hängt das davon ab, ob ein Bundesland das sogenannte „Bundesmodell“ oder eine eigene Berechnungsmethode anwendet:
Die Steuermesszahl beim „Bundesmodell“ beträgt dann einheitlich für die neuen und alten Bundesländer:
- 0,31 Promille für Ein- und Zweifamilienhäuser, Wohnungen und Mehrfamilienhäuser
- 0,34 Promille für alle anderen Grundstücksarten (z. B. unbebaute Grundstücke und Geschäftsgrundstücke)
- Zudem wird der soziale Wohnungsbau gefördert: Entsprechende Immobilien erhalten einen Abschlag von 25 Prozent auf die Steuermesszahl.
- Baudenkmäler werden durch einen Abschlag von 10 Prozent auf die Steuermesszahl steuerlich begünstigt.
Was verbirgt sich hinter dem Grundsteuer-Hebesatz?
Der Grundsteuer-Hebesatz ist ein weiterer Faktor, um die Grundsteuer zu berechnen. Er wird in Prozent angegeben. Der Grundsteuer-Hebesatz wird von den einzelnen Gemeinden eigenständig festgesetzt. Dadurch können sich die Sätze auch innerhalb eines Bundeslands deutlich unterscheiden (Grundsteuerranking 2024).
Beispiel: Ende 2024 hat der Stuttgarter Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer ab 1.1.2025 von vorab 520 Prozent auf 160 Prozent zu senken. Die bisherige Grundsteuer war 2024 damit dreimal so hoch wie die zukünftige.
Der Grundsteuer-Hebesatz ist also ein wichtiger Faktor, mit dem die Gemeinden die Höhe der Grundsteuer beeinflussen können. Ein hoher Hebesatz sorgt für mehr Einnahmen. Ein niedrigerer Grundsteuer-Hebesatz mindert die finanzielle Flexibilität der Gemeinde, kann aber die Attraktivität des Ortes für Immobilienkäufer:innen steigern.
Wie finde ich den Hebesatz meiner Gemeinde heraus?
Den aktuellen Hebesatz Ihrer Gemeinde oder Stadt finden Sie auf der offiziellen Webseite Ihrer Kommune oder im Grundsteuerbescheid. Viele Städte veröffentlichen die Hebesätze jährlich online.
Eine Übersicht der Hebesätze deutscher Städte und Gemeinden 2024 finden Sie auch auf der Website der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
Grundsteuer berechnen: So gehen Sie vor
Wir kennen nun die drei Faktoren, aus denen sich die Grundsteuer errechnet. Die Berechnung selbst geht ganz einfach, Sie müssen lediglich die drei Faktoren miteinander multiplizieren.
Berechnung der Grundsteuer ab 2025
| Einheitswert x Steuermesszahl x Hebesatz = Grundsteuer (Berechnungsformel ab 2025) |
Die Rechnung wird noch ein bisschen einfacher, da Grundstückseigentümer:innen den Grundsteuermessbetrag – der sich aus dem Einheitswert und der Steuermesszahl ergibt – aus ihrem Grundsteuerbescheid ablesen können:
| Grundsteuermessbetrag x Hebesatz = Grundsteuer |
Beispiel: Berechnung der Grundsteuer 2025 für ein Einfamilienhaus (nach Bundesmodell)
In unserem fiktiven Beispiel gehen wir von einem Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 170 Quadratmetern mit angebauter Doppelgarage aus. Der Grundsteuerwert liegt bei 470.000 Euro. Bei der Berechnung werden die Steuermesszahlen des Bundesmodells angewandt. Der Hebesatz der Gemeinde liegt bei 400 Prozent.
| Grundsteuer | = Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz |
| = (470.000 Euro x 0,31 Promille) x 400 Prozent | |
| = 147,87 Euro x 400 Prozent | |
| = 591,48 Euro |
Berechnung der Grundsteuer bis 2024
| Einheitswert x Steuermesszahl x Hebesatz = Grundsteuer (Berechnungsformel bis 2024) |
Beispiel: Berechnung der Grundsteuer 2024 für ein Einfamilienhaus
Der Einheitswert für ein Grundstück mit einem Einfamilienhaus in Stuttgart wurde 2024 mit 80.000 Euro festgelegt. Die Steuermesszahl für Einfamilienhäuser beträgt bis 31.12.2024 in den alten Bundesländern 2,6 Promille für die ersten 38.346,89 Euro des Einheitswerts und 3,5 Promille für den Rest des Einheitswerts. In Stuttgart liegt der Grundsteuerhebesatz 2024 bei 520 Prozent. Die Rechnung sieht also wie folgt aus:
| Grundsteuer | = Einheitswert x Steuermesszahl x Hebesatz |
| = (38.346,89 Euro x 0,0026 + 41.653,11 Euro x 0,0035) x 520 Prozent | |
| = 245,48 Euro x 520 Prozent | |
| = 1.276,51 Euro |
Achtung: Verwechslungsgefahr mit der Grunderwerbsteuer Nicht verwechseln sollten Sie Grundsteuer und Grunderwerbsteuer. Letztere fällt nur einmal – wie der Name schon sagt beim Erwerb eines Grundstücks an. Die Grunderwerbsteuer ist je nach Bundesland unterschiedlich hoch. Die Grundsteuer müssen Sie jährlich zahlen!

Wie oft muss ich Grundsteuer zahlen?
Das Finanzamt setzt die Grundsteuer im Voraus für ein ganzes Kalenderjahr fest. Das geschieht entweder im Grundsteuermessbescheid (auch als Grundsteuerbescheid bezeichnet) oder durch eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde.
Die Steuer wird normalerweise zu je einem Viertel zu den folgenden Daten fällig:
- 15. Februar
- 15. Mai
- 15. August
- 15. November
Sie können aber auch Vorauszahlungen leisten oder die gesamte Grundsteuer für ein Jahr auf einen Schlag zahlen. In diesem Fall müssen Sie bereits im Vorjahr einen Antrag stellen, die Zahlung der Steuersumme wird dann jährlich zum 1. Juli fällig.
Grundsteuerbefreiung: In diesen Fällen wird keine Steuer fällig
Wie bei jeder Regel gibt es auch bei der Grundsteuer ein paar Ausnahmen: Nicht auf jedes Grundstück muss Grundsteuer gezahlt werden und bestimmte Grundstücke profitieren von einer Grundsteuerbefreiung. Darunter ist zum Beispiel Grundbesitz der Kommunen, Länder und des Bundes sowie Grundbesitz, der durch das Bundeseisenbahnvermögen für Verwaltungszwecke genutzt wird. Darüber hinaus wird die Grundsteuer erlassen für:
- Bildungseinrichtungen,
- Kulturgüter und gemeinnützige Grünanlagen,
- Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen,
- Religionsgemeinschaften und Dienstwohnungen von Geistlichen und Kirchendiener:innen sowie
- wissenschaftliche Einrichtungen.
Ihr Grundeigentum fällt nicht in eine dieser Kategorien? Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es trotzdem eine Chance auf einen teilweisen Grundsteuererlass:
Erlass der Grundsteuer wegen wesentlicher Ertragsminderung
Hatten Sie als Vermieter:in erhebliche unverschuldete Mietausfälle, kann ein Teil der Grundsteuer erlassen werden. Bei einer Ertragsminderung von 50 Prozent können 25 Prozent der Grundsteuer erlassen werden. Dazu müssen Sie bis zum 31. März des Folgejahres einen Antrag stellen.
Erlass der Grundsteuer aus Billigkeitsgründen
Liegen besondere Härtegründe vor, kann die Grundsteuer ausnahmsweise aufgeschoben werden. Das ist der Fall, wenn die Zahlung der Grundsteuer die persönliche oder wirtschaftliche Existenz bedrohen und den täglichen Lebensunterhalt der:des Steuerpflichtigen gefährden würde.
Erlass der Grundsteuer bei denkmalgeschützten Immobilien
Auch Immobilien, die unter Denkmalschutz stehen, können auf Antrag von der Grundsteuer befreit werden. Die Grundsteuerbefreiung wird jedoch nur genehmigt, wenn die zu deckenden Kosten die jährliche Rendite Ihrer Immobilie übersteigen.
FAQ: Häufige Fragen zur Grundsteuer
Wie Sie sehen, ist die Grundsteuer ganz schön umfangreich und komplex. Wir hoffen, dass Sie sich als Immobilen- und Grundstückseigentümer:in mit unserem Artikel einen guten Überblick verschaffen konnten – und in Zukunft steuerlich möglichst günstig fahren!
Es gibt noch ein paar oft gestellte Fragen, die wir Ihnen zum Abschluss beantworten möchten:
Im Zuge der Grundsteuerreform mussten ca. 36 Millionen Grundstücke und Immobilien in Deutschland neu bewertet werden. Die Reform gilt seit 2025 – doch schon zuvor mussten Eigentümer:innen eine „Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts“ abgeben. Das erfolgte im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Januar 2023.
Aus den Erklärungen ermittelten die Finanzverwaltungen für jede wirtschaftliche Einheit den neuen Grundsteuerwert und multiplizierten diesen mit den neuen festgeschriebenen Steuermesszahlen. Das Ergebnis ist ein neuer Grundsteuermessbetrag.
Vielleicht fragen Sie sich, wieso Sie die Erklärung bereits zwei Jahre zuvor abgeben mussten, wenn die Reform erst ab 2025 greift. Das soll den Finanzämtern etwas Zeit verschaffen – schließlich mussten diese bis zum Jahr 2025 mehrere Millionen von Häusern, Wohnungen und Grundstücken neu bewerten.
Die Grundsteuer zählt zu den umlagefähigen Nebenkosten. Vermieter:innen können die Grundsteuer in der Betriebskostenabrechnung anteilig auf Mieter:innen umlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten:
• Der Umlageschlüssel ist im Mietvertrag festgeschrieben.
• Wenn das nicht der Fall ist, wird die von den Mietenden genutzte Wohnfläche als Umlageschlüssel herangezogen.
Am einfachsten ist die Berechnung, wenn die Immobilie komplett vermietet ist: Dann kann die Grundsteuer zu 100 Prozent umgelegt werden. Wohnen Sie selbst mit im Haus, müssen Sie einen Teilbetrag der Grundsteuer – entsprechend Ihrer anteiligen Wohnfläche – selbst zahlen.
Vermieten Sie eine Immobilie, können Sie die Grundsteuer von der Steuer absetzen. Dazu geben Sie die gezahlte Grundsteuer in der Steuererklärung als Werbungskosten an. Den Wert tragen Sie bei den „Einkünften aus Vermietung und Verpachtung“ in der Anlage V ein.
Das gilt natürlich nur, wenn Sie die Kosten selbst tragen. Wird die Grundsteuer ohnehin auf Mietende umlegt, können Sie keinen Werbungskostenabzug geltend machen.
Wer eine Immobilie oder Wohnung selbst nutzt, geht leer aus – die Grundsteuer ist in diesem Fall nicht steuerlich absetzbar.
Die meisten Vermietenden legen die Grundsteuer auf Mieter:innen um. Das geschieht mit der Nebenkostenabrechnung, in der die Grundsteuer dann als separater Posten aufgelistet wird. Mieter:innen können Ausgaben für die Grundsteuer nicht von der Steuer absetzen. Das gilt auch für Eigentümer:innen, die eine Immobilie selbst nutzen.
Ein Ausnahmefall liegt vor, wenn der Mieter oder die Mieterin ein Arbeitszimmer absetzen kann. Hier kann die anteilige Warmmiete als sogenannte „Betriebsausgabe“ von der Steuer abgesetzt werden. Die Grundsteuer ist hierin enthalten und wird sozusagen mit abgesetzt. Für steuerlich anerkannte Arbeitszimmer gelten allerdings strenge Regeln.
Im Grundsteuerbescheid werden die Höhe der zu zahlenden Grundsteuer, der zugrunde gelegte Einheitswert bzw. Grundsteuerwert, der Steuermessbetrag sowie der angewendete Hebesatz und die Zahlungsfristen mitgeteilt. Der Bescheid enthält alle Werte und Faktoren zur Berechnung Ihrer individuellen Grundsteuer.
Prüfen Sie den Bescheid sorgfältig. Bei Unstimmigkeiten können Sie innerhalb eines Monats nach Eingang des Bescheids Einspruch einlegen.
Hinweis: In manchen Fällen muss der Einheitswert/Grundsteuerwert neu bestimmt werden. Zum Beispiel, wenn ein Haus neu gebaut wird, grundlegende bauliche Veränderungen stattfinden (Anbau oder ähnliches) oder wenn ein Grundstück aufgeteilt wird. Die Feststellung des neuen Grundsteuerwertes (sogenannte Nachfeststellung) findet zum 1. Januar des Folgejahres statt.
Haben Sie als Grundstückseigentümer:in (noch) keine Grundsteuererklärung ans Finanzamt übermittelt und trotzdem einen Steuerbescheid vom Finanzamt erhalten? Wenn ja, handelt es sich hierbei um Schätzungen des Finanzamts. Und in der Regel wird die Grundsteuer meist zu Ungunsten der Grundstückseigentümer:innen geschätzt. Das sollte man bei einer Schätzung beachten:
• Trotz Schätzung besteht nach wie vor die Pflicht zur Übermittlung einer Grundsteuererklärung.
• Wird eine Grundsteuererklärung nach einer Schätzung eingereicht, wird das Finanzamt die Steuerbescheide in der Regel ändern, denn die Schätzbescheide stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.
• Im Steuerbescheid wird das Finanzamt einen Verspätungszuschlag festsetzen.
Als Erb:in müssen Sie in der Regel keine neue Grundsteuererklärung unmittelbar nach dem Erbfall abgeben, aber Sie sind verpflichtet, das Finanzamt über den Eigentumsübergang zu informieren. Erst wenn das Finanzamt Sie auffordert oder sich an den Grundstücksdaten etwas ändert (z. B. Umbau, Nutzung), ist eine neue Erklärung notwendig.
Es gibt keine allgemeinen Freibeträge für die Grundsteuer. Es existieren jedoch bestimmte Ausnahmen und Befreiungen, z. B. für gemeinnützige, kirchliche oder öffentliche Grundstücke sowie in besonderen Härtefällen.
Die Höhe der zukünftigen Grundsteuer hängt vom Hebesatz Ihrer Gemeinde sowie von politischen Entscheidungen ab – viele Expert:innen rechnen langfristig mit moderaten Steigerungen.